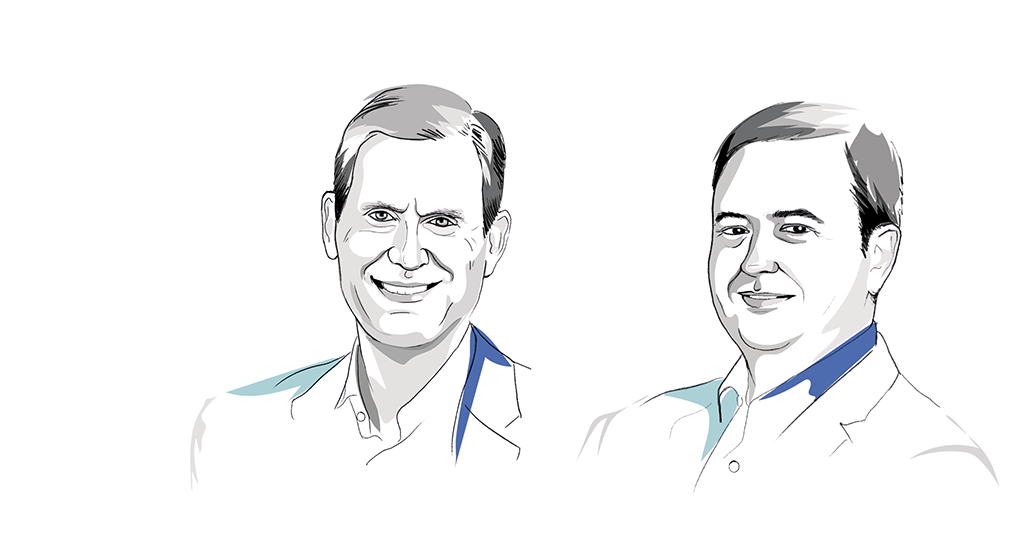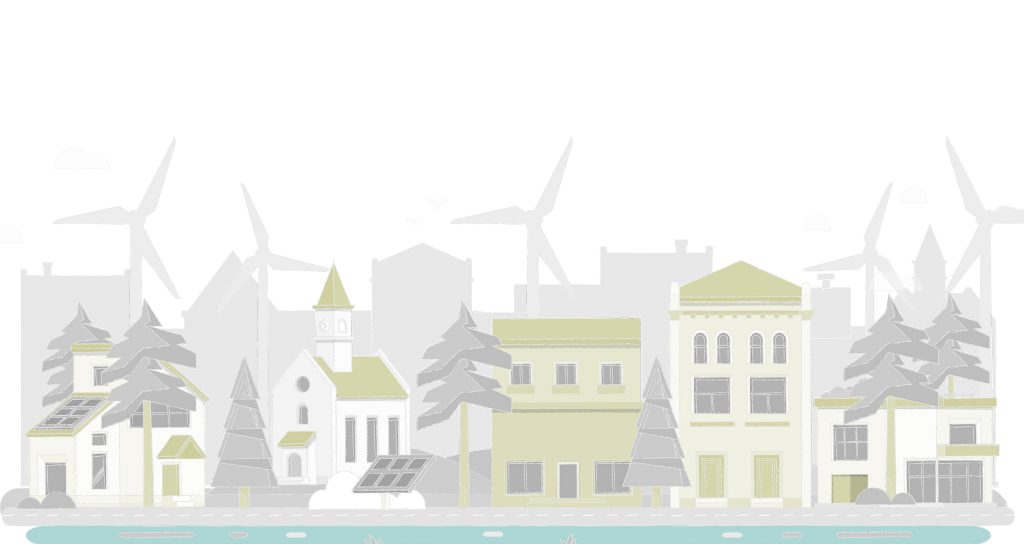Disruptive Technologien führen zur Destabilisierung des urbanen Umfelds … Wie ist das zu verstehen? Wie kann man die Diskrepanz zwischen dem „magischen Denken” der Smart City und der Realität der Stadt überwinden? Wie kann man den Dialog zwischen Governance und Innovation herstellen? Mit diesen Fragen u. a. befasst sich die im April 2018 veröffentlichte französische Studie „Audacities. Innover et gouverner dans la ville numérique réelle” („Audacities, Innovation und Governance in der realen digitalen Stadt”). Darüber sprechen die beiden Verfasser Thierry Marcou (Fondation Internet Nouvelle Génération) und Mathieu Saujot (Institut du développement durable et des relations internationales) mit Cécile Maisonneuve, Vorsitzende von La Fabrique de la Cité.
Was war der Ausgangspunkt für die Studie „Audacities, Innovation und Governance in der realen digitalen Stadt”?
Thierry Marcou. Für die Fondation Internet Nouvelle Génération (FING) ist diese Studie das letzte Kapitel einer Reihe von Arbeiten zum Thema digitale Stadt, die wir mit unserer 2006 erschienenen Publikation „Ville 2.0, plateforme d’innovation ouverte“ („Stadt 2.0, offene Innovationsplattform”) begonnen haben. Zwölf Jahre später genügt es nicht mehr, die urbanen Innovationen nur nacheinander zur Kenntnis zu nehmen, aufzuspüren, was nicht funktioniert, und zu analysieren, wie tief der Abgrund zwischen den besänftigenden Versprechen von Reibungslosigkeit seitens der Start-ups und Befürworter der Smart City und der städtischen Realität ist, welche verwirrend, kompliziert, von neuen Spannungen belastet ist – ausgelöst durch die Vorgehensweisen disruptiver Anbieter.
Mathieu Saujot. Das Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI) ist auf Governance-Fragen spezialisiert. FING befasst sich ihrerseits mit Innovationsfragen. Mit der gemeinsamen Studie haben wir beide Fachgebiete in Resonanz zueinander gesetzt. Ohne diese Zusammenarbeit wäre es uns wahrscheinlich nicht gelungen, das magische Denken der Smart City aus einem kritisch relevanten Blickwinkel zu untersuchen.
Cécile Maisonneuve, erscheint Ihnen diese kritische Lesart der Smart City und ihres magischen Denkens gerechtfertigt?
Cécile Maisonneuve. Sie ist sogar sehr gesund! Bei La Fabrique de la cité vermeiden wir es, den Begriff „Smart City” zu verwenden. Aber er kursiert nun mal seit zwanzig Jahren. Was mich wundert ist, dass, obwohl man im Allgemeinen dieses magische Denken bemängelt, die Smart City weiterhin in Kolloquien und Konferenzen thematisiert wird. Man hat den Eindruck, dass der Begriff „Smart City“ sich trotz der Spannungen, die Thierry Marcou gerade erwähnt hat, hält, obwohl er längst tot und begraben sein sollte. Vielleicht gerade weil die Innovation ihr Versprechen nicht einlöst und die Lage der Städte sich verschlechtert und weiterhin starker Diskussionsbedarf besteht.
Den Begriff „Smart City” in Frage zu stellen, ist sicher nicht ausreichend. Ein gewählter Volksvertreter fragte mich neulich: „Okay, wir geben die Smart City auf. Aber womit ersetzen wir sie?”
M.S. Den Begriff „Smart City” in Frage zu stellen, ist sicher nicht ausreichend. Ein gewählter Volksvertreter fragte mich neulich: „Okay, wir geben die Smart City auf. Aber womit ersetzen wir sie?” Wahrscheinlich müssen wir auf Konzepte zurückgreifen – die Smart City ist eines –, um die Debatte zu führen.
C.M. Das ist ein Versuch, diese Vielschichtigkeit anzugehen, die sich schwer eingrenzen lässt. Hinter diesem Begriff steckt ein dringendes Bedürfnis nach Narration, einer gemeinsamen Erzählung. Das Problem ist: Wenn man vage Begriffe benutzt, die schnell verwässern, versteht man nicht mehr, was sie eigentlich bedeuten, und man glaubt, von der gleichen Sache zu sprechen, obwohl das nicht zutrifft. In dem Zusammenhang frage ich mich, ob die Idee der Resilienz nicht dabei ist, die der Smart City als Sammelbegriff für alles Mögliche abzulösen.
Abgesehen von Konzepten geht aus Ihren Arbeiten hervor, dass die urbanen disruptiven Akteure der Realität der Stadt gegenüber blind sind? Wie erklärt sich das?
C.M. Die Start-up-Unternehmen haben eine stark technisch-lösungsorientierte Einstellung und oft keine ausgeprägte institutionelle Kultur. Das hemmt eindeutig die Effizienz ihrer Lösungen; denn Demokratie denken bedeutet Zeit denken. Wenn man von der Stadt, jedenfalls der inklusiven Stadt spricht, ohne auch den Faktor Zeit zu bedenken, geht das unweigerlich schief. Anzumerken wäre auch, dass die großen digitalen Plattformen – die berühmten GAFAM – alle auf der gleichen Doppelkultur aufgebaut sind: Monopolkultur (wenn sie auf einen Markt vordringen, ist ihr Ziel der gesamte Markt, nicht nur ein Marktsegment) und Geheimniskultur. Kurzum: genau das Gegenteil der gesellschaftlichen Forderung nach mehr Zusammenarbeit und Transparenz.
M.S. Die Monopol- und Geheimniskultur funktioniert in der virtuellen Welt gut. Die disruptiven Akteure brauchen sie, um ihren magischen Diskurs glaubhaft zu machen. Aber in der realen Stadt ist sie kaum haltbar. Das Monopol hält den Ausschreibungsrunden öffentlicher Aufträge nicht stand. Genauso wenig hält das Geheimnis bei der Übertragung öffentlicher Versorgungsdienste stand.
Die Start-up-Unternehmen haben eine stark technisch-lösungsorientierte Einstellung und oft keine ausgeprägte institutionelle Kultur. Das hemmt eindeutig die Effizienz ihrer Lösungen.
Berücksichtigen die Start-ups nicht bereits selbst dieses Reibungspotenzial mit der Wirklichkeit?
T.M. Das Phänomen „Audacities” wurde mit der disruptiven und schnell wachsenden Einflussnahme von Uber, Deliveroo, Airbnb, Amazon und ihrer finanziellen Schlagkraft eingeläutet. Doch die Entwicklung der letzten Monate ist beeindruckend. Das Beispiel Uber ist hier bezeichnend. Das Start-up-Unternehmen hat sich zunächst extrem disruptiv und exklusiv verhalten. Heute unterzeichnet es in den Vereinigten Staaten Vereinbarungen mit Städten und unterstützt subventionierte öffentliche Verkehrsmittel im Rahmen eines globalen öffentlichen Mobilitätsangebots. In Frankreich gibt Uber offen seine Bereitschaft kund, mit bestimmten Städten zu diskutieren, um deren öffentliches Mobilitätsangebot zu ergänzen. Das Gespräch kommt also schlussendlich zustande.
C.M. Lassen Sie es mich positiv formulieren: Es stimmt, die Plattformen haben sich an der Realität gestoßen. Aber sie haben uns auch die Realität vor Augen geführt. Wir können z. B., Uber und Konsorten sei Dank, nicht mehr behaupten, wir wüssten nichts von den Mängeln und Grenzen unserer Mobilitätssysteme, vor allem der öffentlichen. Die Plattformen stellen uns vor unsere eigene Unzulänglichkeit in Sachen Governance.
T.M. Dieses Problem lässt sich nicht auf eine binäre Gleichung reduzieren. Auch wenn uns die Grundlagen und Werte kollektiver Systeme wichtig sind, nutzen wir diese disruptiven Dienste gern, selbst wenn wir dabei unterbezahlte Fahrradlieferanten in Anspruch nehmen. Gleichzeitig lässt sich nicht leugnen, dass Uber zumindest in der Region Île-de-France die Mängel des öffentlichen Verkehrsnetzes durch Fahrgemeinschaften ergänzt. Wenn man sieht, wie schleppend sich Fahrgemeinschaften entwickeln, wie hartnäckig das Ein-Personen-Fahrzeug die Regel bleibt, erkennt man all die verpassten Gelegenheiten, die man nicht rechtzeitig genutzt hat, während man gleichzeitig mit dem Finger auf Uber gezeigt hat, weil Uber das Taxi-Monopol bedrohte!
Die Städte tragen also einen Teil der Verantwortung dafür, dass der konstruktive Dialog mit den Plattformen nicht zustande kam?
M.S. Es gibt auch kulturelle Hemmnisse seitens der öffentlichen Hand. Wenn eine Stadt bei zehn auf Fahrgemeinschaften spezialisierten Start-Ups entscheidet, alle zehn zu unterstützen, obwohl jedes Unternehmen eine kritische Masse braucht, um wachsen zu können, dann kann man von vorprogrammiertem Scheitern sprechen. In China wählen die Städte einen einzigen Gewinner aus und begleiten ihn dann umfassend in seiner Entwicklung. In Frankreich müssten wir das richtige Gleichgewicht finden, damit die Innovation vorankommt und eine gewisse Chancengleichheit gewährleistet bleibt. Wir müssten in der Lage sein, zu sagen „In diese Richtung wollen wir gehen”, und dann die Mittel dafür bereitstellen.
Wie kann man den Dialog zwischen Governance und Innovation stärken?
C.M. Wenn es einen Zugang gibt, dann ist das die politische Ebene. Die Aufgabe eines gewählten Volksvertreters ist es, eine Vision aufzuzeigen, klar zu definieren, was er über seine sechsjährige Mandatszeit hinaus für seine Stadt erreichen will. In dieser Hinsicht sind interessante, breit aufgestellte, zukunftsorientierte Ansätze zu beobachten – ich denke dabei an „Bordeaux Métropole 2050” –, obwohl in Frankreich die Zukunftsforschung meist Hoheitsgebiet des Staates oder großer Unternehmen ist.
T.M. Dem stimme ich zu. Die Innovation ist ein politisches Thema. Lassen Sie uns also diskutieren. Ich erwarte von Kandidaten, dass sie persönlich Stellung beziehen, zum Datenschutz, zum autonomen Fahrzeug, zu vernetzten Geräten. Um jedoch das magische Denken zu entkräften und der Innovation eine Richtung zu geben, brauchen die urbanen Akteure stichfeste Bewertungsmethoden und Leseraster. Hier muss man sich mit den Werkzeugen befassen. Man könnte auch darüber nachdenken, welche Maßstäbe und Vergleichswerte am besten geeignet sind, die Entscheidungsfindung zu unterstützen. Schließlich haben sich die europäischen Städte auch im Rahmen des C40 abgestimmt, um auf das Phänomen Airbnb zu reagieren …